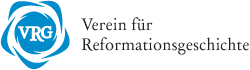Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte
QFRG 63 - Concordia controversa
I. Dingel, Gütersloh 1996, € 76,-Die Konkordienformel gilt in der kirchenhistorischen Forschung gemeinhin als der Abschluss der lutherischen Konfessionsbildung und der Beginn der lutherischen Orthodoxie. Die als Habilitationsschrift im Jahre 1993 an der Theologischen Fakultät der Universität Heidelberg vorgelegte Arbeit „Concordia controversa“ bricht diese Sicht auf und zeigt dagegen, wie offen die lehr- und bekenntnismäßige Situation noch war, in die hinein die Konkordienformel als entscheidender Schritt im Prozess der Konfessionalisierung traf. Trotz des mit großem Einsatz verfochtenen Ziels der Stiftung einer Bekenntniseinheit nach den Jahrzehnten innerprotestantischer Auseinandersetzung, konnte die Konkordienformel zunächst nur sehr wenig zu einer konfessionellen Homogenisierung beitragen. Dies zeigen die zahlreichen Druckschriften, in denen Territorien, Städte und Theologengruppen nicht nur ablehnend Stellung nahmen, sondern auch ihre jeweils eigene Theologie vor allem im Blick auf Abendmahl, Christologie und den Umgang mit Lehr- und Bekenntnisautoritäten formulierten. Statt einigend zu wirken, ließ die Konkordienformel die ganze Variationsbreite konfessioneller Standpunkte in die Öffentlichkeit treten. In der öffentlich geführten, kontroversen Diskussion um ihre Annahme bzw. Ablehnung wird deshalb deutlich, ein wie breiter Fächer unterschiedlicher bekenntnismäßiger Spielarten noch bis in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges weiterhin bestand.
Die Untersuchung zeichnet den Gang der Kontroversen nach, bindet sie begründend in die politischen Voraussetzungen, Ziele und territorialen Verknüpfungen ein, setzt Akzente auf die Schlüsselfiguren der Bekenntnisbildung und der zweiten und dritten nachreformatorischen Generation, auf deren bildungsmäßigen Hintergrund sowie auf das Netzwerk ihrer ‚interterritorialen’ und internationalen Beziehungen und arbeitet schließlich die theologischen Merkmale der jeweils eingeschlagenen konfessionellen Option vergleichend heraus. Dabei wird zugleich deutlich, dass die bisherige theologische Interpretation der Konkordienformel viel zu oft von konfessionalistischer Geschichtsschreibung gelenkt war und die integrative Kraft, die sich selbst noch in der „Apologie des Konkordienbuchs“ von 1583/1584 spiegelt, übersehen hat.